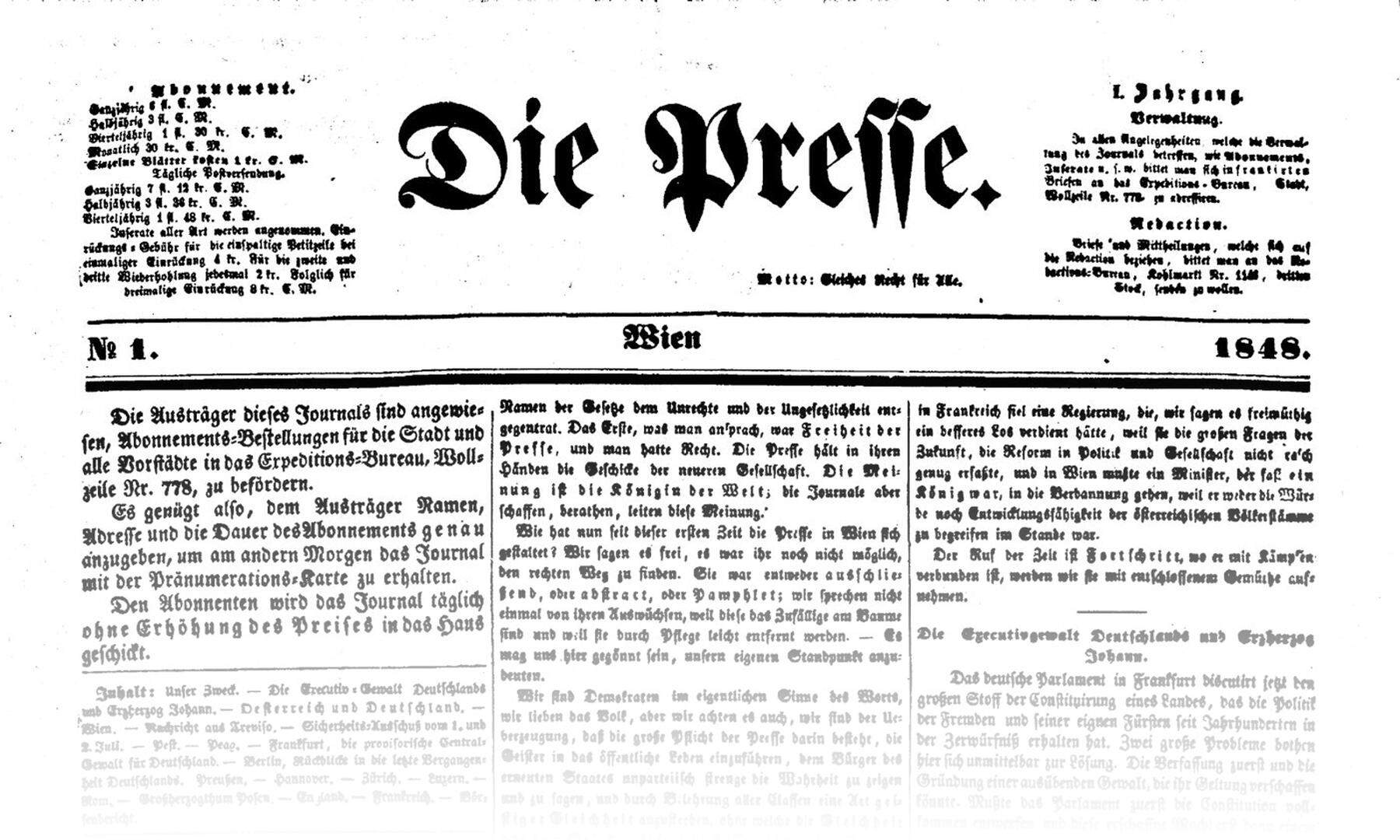
In Mittelschulen werden nicht-katholische Schüler in eigenen Klassen gesammelt, teils aber auch im Klassenraum abgesondert.
Neue Freie Presse am 25. September 1934
Der Erlaß des Unterrichtsministeriums, daß in Mittelschulen mit Parallelklassen eine Absonderung der nichtkatholischen Schüler und ihre Zusammenfassung in eine eigene Klasse vorgenommen werden soll, ist bereits in Durchführung begriffen. Dabei hat sich aber, wie wir erfahren, gezeigt, daß der Erlaß vielfach, sei es mit oder ohne Absicht, eine Auslegung erfahren hat, die bei Eltern nichtkatholischer Schüler lebhafte Beunruhigung auslöste.
Der Erlaß hat nämlich in manchen Fällen auch dort Anwendung gefunden, wo Parallelklassen nicht vorhanden sind, wo also eine Absonderung der nichtkatholischen Schüler innerhalb eines Klassenraumes vorgenommen wurde. Vom Unterrichtsministerium wird allerdings nach wie vor betont, daß der Verfügung in keine Richtung eine andere Absicht zugrunde liege als die, notwendige Ersparungsmaßnahmen durchzuführen und schultechnische Vorteile zu erreichen. Der Wirkungskreis wurde, wie betont wird, ausdrücklich auf solche Anstalten beschränkt, in denen Parallelklassenzüge wegen der großen Zahl der Schüler notwendig sind.
Wenn z.B in einem Jahrgang 70 Schüler auf zwei Klassen aufgeteilt sind, und man in diesem Falle keine Trennung der katholischen von den nichtkatholischen Schülern vornähme, so würde, abgesehen von den Schwierigkeiten der räumlichen Unterbringung, der Religionsunterricht auch erhöhte Kosten verursachen. Denn jeder Klasse müsste für die katholischen wie auch für den nichtkatholischen Schüler die entsprechende Anzahl von Religionsstunden zugewiesen werden. Darüber hinaus würden auch Erleichterungen in der Erstellung des Stundenplanes wegfallen, die durch diese Maßnahme geschaffen werden sollen.
Nichts desto weniger bildet diese Verfügung des Unterrichtsministeriums, nicht zuletzt wegen der in den letzten Tagen beobachteten irrigen Auslegung, den Gegenstand lebhafter Erörterungen und Diskussionen in der nichtkatholischen Elternschaft, die bereits spontan Versammlungen einberufen hat. In diesen Kreisen wird darauf verwiesen, daß früher wohl an den Volks-, nicht aber an den Mittelschulen eine solche Teilung geübt wurde. Auch die Israelitische Kultusgemeinde wird sich mit dem Erlaß beschäftigen.
Es ist auch anzunehmen, daß sich die zuständige Stelle der Unterrichtsverwaltung nochmals mit der Verfügung und ihrer Anwendung beschäftigen dürfte. Ebenso kann angenommen werden, dass sich die Unterrichtsverwaltung mit den in Betracht kommenden Kreisen der Elternschaft und ihrer Vertretung in Verbindung setzen dürfte.
Albert Einstein zu Besuch in Wien
Professor Albert Einstein spricht mit der “Neuen Freien Presse” über das Ziel einer “Art Wiedergeburt des jüdischen Volkes”.
Neue Freie Presse am 24. September 1924
Professor Albert Einstein, der vorgestern aus Berlin hier eingetroffen ist, wird bereits heute wieder nach Deutschland abreißen. Der berühmte Forscher, dessen prachtvoller Gelehrtenkopf mit der von graumeliertem Haar umrahmten mächtigen Stirn und den strahlenden Augen die überragende geistige Bedeutung verrät, hatte die Liebenswürdigkeit, einem unserer Mitarbeiter folgende Mitteilungen zu machen:
“Ich erwarte vom Zionismus eine Art Wiedergeburt des jüdischen Volkes, und zwar in dem Sinne, daß durch die gemeinsame Arbeit und das gemeinsame Ziel die Liebe der Juden zu ihrem Volke wieder in voller Kraft lebendig werde und sie befähige, diejenige Würde wiederzuerlangen, die sie unter der Einwirkung der äußeren Lebensfaktoren oft haben vermissen lassen müssen. Dieses begeisternde Ziel einer Wiedergeburt des jüdischen Volkes schien mir wichtig genug, um nach Wien zu kommen und zu versuchen, das Interesse der hiesigen Juden für dieses Problem zu erregen. Mein Wiener Aufenthalt hat ausschließlich den Zweck, im Dienste des jüdischen Volkes das meine zu tun.
Meine zionistische Gesinnung ist nicht etwa eine Folge meiner Palästinareise, sondern reicht in ihrer Entwicklung viel weiter zurück. Allerdings schöpfte meine Überzeugung aus meinem Aufenthalt in Palästina neue Kraft und Zuversicht. Ich habe in Palästina eine Entwicklung und einen Zustand der landwirtschaftlichen und städtischen jüdischen Siedlungen gesehen, die mir den unerschütterlichen Glauben an das Gelingen der jüdischen Kolonisation Palästinas gibt. Meine Gesinnung ist aus der Betrachtung der inneren und äußeren Verhältnisse entstanden, unter denen die deutschen Juden der gebildeten Schichten existieren. Ich hatte den Eindruck, daß die Juden durch ihr vollständiges Ungebundensein, zu dem noch der Antagonismus der Umgebung hinzu kommt, in eine psychische Situation geraten sind, aus der ich nur in der angedeuteten Weise einen Ausweg sehe.
Ich hoffe, daß auch die österreichischen Juden die Aktion für den Wiederaufbau Palästinas, die hier von meinem Freunde Blumenfeld in die Wege geleitet wird, in der gleichen Weise fördern werden, wie es die Juden in Deutschland und Amerika tun.”
Glück und Ende eines Theaterdirektors
Er bescherte den Menschen in London großes Vergnügen und Gesprächsstoff, doch es war schlichtweg zu teuer.
Neue Freie Presse am 23. September 1924
Der Londoner Theaterdirektor Cochrane, der, wie berichtet wurde, mit Passiven von 80.000 Pfund Sterling seinen Bankerott erklären musste, hat während der letzten 15 Jahre in der Londoner Oeffentlichkeit eine vielbeachtete Rolle gespielt. Den Grundstock zu seinem Vermögen hatte er durch Spielgewinne und glückliche Spekulationen gelegt. Zunächst figurierte er als Veranstalter von Boxkämpfen und als Impresario bekannter Boxmatadore. Er hatte rießige Boxmatches organisiert und daran große Summen verdient.
Nachdem er aller finanziellen Sorgen enthoben war, wollte er sich den Luxus leisten, sich nunmehr auch auf künstlerischem Gebiete zu betätigen. Er hat dem Londoner Theater en eine Reihe keineswegs wertloser Anregungen gegeben und die „Miraltel“-Aufführungen, die einen ungeheuren Erfolg beim Londoner Publikum hatten, waren nicht zuletzt durch seine energische Initiative und sein organisatorisches Talent zustandegekommen.
Er war ein Meister in der Kunst, Geld aus dem Boden zu stampfen. Mehrere Londoner Theater gehörten ihm, darunter das New-Oxford-Theater und der London-Pavillon. Seine Vorliebe für luxuriöse Ausstattung und prachtvolle Inszenierung konnte ich voll ausleben, als er verschiedene Reviews auf die Bühne brachte und einen derartigen Farbenglanz der Kostüme und Dekorationen ins Leben rief, wie er selbst im verwöhnten London durchaus ungewohnt war.
Diese Ausstattungsstücke waren mit riesigen Spesen, die manchmal mehrere Zehntausende von Pfunde betrugen, verbunden, und wenn sich auch das Publikum oft monatelaug zu diesen Revuen drängte, so konnten die exorbitanten Kosten doch häufig nicht hereingebracht werden. Nachdem er in diesen Revuen seine schwelgerische Phantasie eine zeitlang ausgetobt hatte, brachte er, unermüdlich in seiner Aktivität, einige große amerikanische Filme nach England. Er hatte auch das russische Kabarett dem Londoner Publikum vorgestellt. Eine ganz besondere Spezialität, die in London lebhaften Anklang fand, waren die sogenannten Plantagenkabarette, die er aus Amerika importierte und bei denen farbige Künstler aus Florida und den Südstaaten der Union auf einer im Stil eines Plantagenhauses eingerichteten Bühne auftraten.
Alle diese Unternehmungen gaben zwar den Londonern willkommenen Gesprächsstoff, waren aber meist mit viel zu großen Kosten verbunden, um lukrativ zu sein.
Sensation auf den Pariser Rennplätzen
Ein angeblicher Franzose gewinnt und gewinnt – und soll bald 150 Millionen Francs besitzen.
Neue Freie Presse am 22. September 1934
Aus Paris wird uns berichtet: Auf den Pariser Rennplätzen taucht seit einigen Tagen ein geheimnisvoller Besucher auf, der mit seinem beispiellosen Spielerglück den Neid aller anderen Rennplatzbesucher erregt. Er gewinnt mit unglaublich hohen Einsätzen ausnahmslos und unfehlbar.
Er hat letzten Sonntag auf ein Pferd 100.000 Francs gesetzt und gewonnen und am folgenden Tag mit gleichem Erfolg sogar 200.00 Francs riskiert. Auf die Frage nach seiner „Methode“ zeigte er wortlos ein kleines Köfferchen, das er bei sich trägt und das 100.000 Francs enthält.
Er gab sogar auf vieles Drängen an, Dubios zu heißen und ein richtiger Franzose zu sein. Auch seine Adresse und Telephonnummer nannte er schließlich, doch waren diese Angaben eine Mystifikation, denn bei dem genannten Telephon meldete sich eine Damenstimme, die den Hunderten von Anrufern nach dem erfolgreichen Glücksritter nicht mehr standhalten kann.
Zuletzt erklärte der geheimnisvolle Spieler auf dem Rennplatz von Vincennes, er werde sich, wenn er 150 Millionen Francs gewonnen habe, ins Privatleben zurückziehen. Das werde bald der Fall sein.
Protest gegen das schöne Wetter
Was hat man von lachender Sonne und lachend blauem Himmel, wenn man selbst nichts zu lachen, sondern im Bureau zu sitzen hat?
Neue Freie Presse am 21. September 1924
Ein Junggeselle schreibt uns: Alles was recht ist, aber was zuviel ist, ist zuviel. Ich meine die Art, wie mit uns umgesprungen wird. Nicht etwa in Genf, sondern in einer womöglich noch höheren Instanz: dem Wetterdepartement des Himmels. Drei Sommermonate lang hat man uns aus unbekannten Gründen auf Regenwasser und Kälte gesetzt, alle Urlaube endeten mit Verbitterung, Fluchen, Schnupfen und Rheumatismus. Und kaum ist man endgültig hier, hat sich abgefunden mit dem verpatzten Sommer und beginnt sich allmählich einzuwintern, so hat die Meteorologische Anstalt nichts Vernünftigeres zu tun, als mit deutlicher Ironie den Beginn anhaltenden schönen Wetters anzuzeigen und nicht genug an dem, sie behält mit dieser Prognose auch noch recht. Was soll einem jetzt dieses schöne Wetter? Was hat man von lachender Sonne und lachend blauem Himmel, wenn man selbst nichts zu lachen, sondern im Bureau zu sitzen hat?
Und noch das Aergerlichste ist: Wien ist jetzt schöner als je. Man könnte sich direkt in die Stadt aufs neue verlieben, wie in die eigene Gattin, was ja manchmal auch ganz nett sein soll. Mit solchen legitim zärtlichen Gefühlen geht man jetzt durch den Spätsommer der Wiener Straßen, und alles, was einem noch vor wenigen Wochen gleichgültig war, erscheint einem nun wieder ganz neu und reizvoll. Was für schöne Dinge man nur in den Auslagen sieht. Beim Delikatessenhändler ein nur durch die Preise gestörtes Stilleben von Kaviar, Scampi, gespickten Rebhühnern, ein Vorwurf für jeden Maler, aber ein noch eindringlicherer Vorwurf für jeden, der sich das nicht leisten kann.
Gleich nebenan lockt die Spezialitätentrafik mit hunderten bunten und exotischen Zigarettenschachteln, sich dem Nikotinteufel zu verschreiben. Ein neuer Zug in den Rauchersitten: die silberne Tabatiere verschwindet, man raucht nur mehr aus der Schachtel und daher noch mehr als früher. Wenigstens wird man mit uns in dem einen Teil des Budgets zufrieden sein. Jeder gute Oesterreicher muß im Interesse der Sanierung möglichst viel rauchen und wenn er selbst dabei draufgeht. Am Kurszettel geht man gleichgültig vorüber: das ist eine überwundene Leidenschaft von gestern. Aber die Frauen sind noch immer schön und anspruchsvoll und durch die vom Friseur frisch bezogene Jugend des Bubikopfes haben sie begründeten Anspruch darauf, diese neue Jugend in Form von Straßen- und Nachmittagskleidern, von kleinen und großen Abendkleidern, von Seidenstrümpfen, Hüten und Pelzen zu genießen.
Vollkommen rätselhaft, wie man das ohne Börse leisten soll. Wenn die Meteorologische Anstalt lieber eine anhaltende Besserung der Kurse prophezeien würde, das wäre viel vernünftiger. Es scheint aber doch Menschen zu geben, die sich nicht von diesem Sommer, sondern sogar vom Francsclearing und von der Baisse erholt haben. Vor dem mondänen Zuckerbäcker drängen sich die überlebenden Privatautos und vor den großen Ringstraßenhotel geht es hoch her, nicht nur in ungarischer Sprache, sondern ganz polyglott. Man merkt es den Fremden an, wie sehr ihnen Wien im Licht der Septembersonne gefällt – jedenfalls besser als im plötzlich abgeschalteten elektrischen Licht …
Und wenn dann die Sonne auf der einen Ringstraßenseite untergeht und auf der anderen vor der Oper die Bogenlampen aufflammen, wenn die immer festlich anmutende Ausfahrt beginnt, dann ist man eine Weile von dem oftgeschauten Bilde ganz fasziniert und kann seiner Verliebtheit nur in dem einen Worte Ausdruck geben: Schön ist Wien! … Es ist doch besser, daß uns vom Wetterdepartement noch ein Nachtragskredit an Sommer und Sonne bewilligt wurde, und deshalb ziehe ich auch meinen Protest gegen das schöne Wetter als vollkommen unbegründet zurück. …
Eine Beschwerde über den Bäderzug nach Böhmen
Die Klosetts befinden sich in einem unmöglichen Zustand.
Neue Freie Presse am 20. September 1924
Wir erhalten von geschätzter Seite eine Beschwerde über den Karlsbad-Marienbader Bäderzug:
„Im vierachsigen Waggon erster und zweiter Klasse befinden sich die beiden W.C. in einem unmöglichen Zustande. Als ich den Kondukteur während der Fahrt am 6. August auf den Zustand dieses Wagenabteils aufmerksam machte und das Nichtfunktionieren der Wasserspülung rügte, ward mir die Antwort: „Die Klosetts sind verstopft.“ Ich hoffte, daß nach dem Passieren der Grenze der Uebelstand beseitigt sein werde, da hiezu doch in Gmünd genügend Zeit vorhanden gewesen wäre. Der czecho-slowakische Kondukteur, den ich ebenfalls aufmerksam machte, meinte, das österreichische Zugspersonal sei daran schuld, daß man die Sache nicht in Ordnung bringen konnte.
Ich setzte voraus, daß dies ein ausnahmsweiser Uebelstand gewesen sei und unterließ es daher eine Anzeige bei den Bahnverwaltungen zu erstatten. Bei meiner Rückreise mit dem Bäderzug Karlsbad-Marienbad-Wien Anfang September geriet ich in den an den Speisewagen unmittelbar folgenden, gleichfalls vierachsigen Waggon und mußte zu meinem Erstaunen wahrnehmen, daß in den beiden W.C. die Wasserspülung nicht funktionierte und sich die Folgen dieses Mißstandes überaus unangenehm bemerkbar machten. Eine Waschfrau, sie sie sonst im D-Zügen in Verwendung stehen, war nicht sichtbar, und meine Reklamationen hatten sowohl bei dem Schaffner in der Czecho-Slowakei als bei jenem in Oesterreich nur ein Achselzucken zur Folge.
Wenn man so hohe Fahrpreise fordert, wie dies jetzt leider der Fall sein muß, so könnte man doch wenigstens für die Erfüllung der bescheidensten hygienischen Forderung Sorge tragen.“
Ein Sekretär Tolstois in Wien
Valentin Bulgakow hatte den intimsten Einblick in die Geschehnisse, welche Tolstois Flucht vorausgingen.
Neue Freie Presse am 19. September 1924
Tolstois letzter Sekretär, Valentin Bulgakow, der vom Sowjet aus Russland verbannt wurde, kommt am 20. d. nach Wien. Bulgakow hatte den intimsten Einblick in die Geschehnisse, welche Tolstois Flucht vorausgingen; er war Sekretär des großen Denkers in dessen letztem Lebensjahr, half ihm bei der Fertigstellung seines Meisterwerkes „Der Lebensweg“ und schlief im Zimmer neben dem des Grafen.
Als Gräfin Tolstoi nach der Flucht ihres Mannes Selbstmord begehen wollte und in den Teich von Jaßnaja Poljana sprang, war es Bulgakow, der sie mit Hilfe ihrer Tochter rettete. Bei Ausbruch des Weltkrieges wurde Bulgakow wegen eines Aufrufes gegen den Krieg eingesperrt. Die Sowjetregierung bestellte ihn zum Direktor des Tolstoi-Museums, doch wurde er wegen seiner öffentlichen Stellungnahme gegen jedwede Diktatur und jeden Terror aus Russland verbannt.
Was Kaiser Franz Joseph seinem Sohn schrieb
Die “Neue Freie Presse” veröffentlicht weitere Aktenstücke aus dem Geheimarchiv von Kaiser Franz Joseph.
Neue Freie Presse am 18. September 1924
Wir setzen heute die Veröffentlichung von Aktenstücken aus dem Geheimarchiv des Kaisers Franz Joseph fort. Kaiser Franz Joseph war frühzeitig bestrebt, den Kronprinzen Rudolph in die Führung der Regierungsgeschäfte einzuweihen. Er stand mit ihm in ständigem Brief- und Depeschenwechsel und erteilte ihm bei allen gegebenen Anlässen die nötigen Weisungen.
Das Familienleben des Herrschers wird durch die nachstehende Depesche an Kronprinz Rudolph charakterisiert: “Innigsten Dank für Deinen Brief. Bitte wegen Wohnung in der Burg für Leopold und Gisela zu veranlassen. Kleine Loge versteht sich von selbst. Ich habe angeordnet, daß man Deine Befehle wegen Bestimmung der Tage für die drei Gödinger Waldjagden einhole. Wir umarmen Euch herzlichst. Mama hat leichte Halsentzündung, ist bereits besser und geht im Garten spazieren”. Expediert Gödöllo, 31. August 1884, 2 Uhr 50 Minuten nachmittags.
Weitere Telegramme des Kaisers an den Kronprinzen Rudolph lauten: “Dein Gamsbock von der gestrigen Pirsche ist gefunden worden. Es schneit noch immer. Ich umarme Euch herzlichst.” Expediert 7. Oktober 1883, 7 Uhr 15 Minuten früh.
“Wann kommst Du? Willst du hier jagen? Wir waren eben bei der Kleinen, die wir bei glänzendstem Humor fanden:” Expediert 16. Juli 1887.
Frankreich diskutiert die Ausländerfrage
Frankreich ist das gastlichste aller Länder, besteht nun aber auf einer schärferen Überwachung der Ausländer.
Neue Freie Presse am 17. September 1934
Welches französische Blatt immer man augenblicklich in die Hand nehmen mag, fast alle beschäftigen sich auf das eingehendste mit der Fremdenfrage. Der Ton, in dem sie sie behandeln, ist mehr oder weniger liebenswürdig, die Schlußfolgerung mehr oder weniger radikal, jedenfalls aber sieht es nach einer regelrechten Kampagne aus, die sich nicht nur in gelegentlichen scharfen Ausfällen, sondern in Artikelserien ausdrückt. Nun muß anerkannt werden, daß Frankreich das gastlichste aller Länder ist, das trotz Krise und innenpolitischer Schwierigkeiten diese Tradition fortzusetzen verstand.
Der Ankömmling, welcher Nationalität auch immer er sein mag, hat, sofern er nicht mit Polizei oder Gericht auf schlechtem Fuß stand, mühelos eine Aufenthaltsbewilligung erlangt, die automatisch und ohne jede Schwierigkeit verlängert wurde. Bis vor zwei Jahren war die Frage der Arbeitsbewilligung, der sogenannten carte de travail, leicht zu lösen. Die bestehenden Hindernisse konnten ohne Schwierigkeiten umgangen werden und es war verhältnismäßig nicht schwer, Brot und Arbeit zu finden. Die steigende Beschäftigungslosigkeit aber hat diesem idealen Zustand ein Ende gemacht, vermutlich auf lange Zeit hinaus. Die Arbeitsbewilligung ist heute sehr schwer zu verschaffen, obwohl es für Geschickte noch immer Umwege gibt, auf denen sie das ersehnte Ziel erreichen.
Die Gerüchte von Massenausweisungen Fremder, die im Auslande kolportiert wurden, sind nicht völlig unwahr, sondern beschränken sich auf einen Bruchteil der Wirklichkeit. Tatsächlich haben in den letzten Monaten zahlreiche Ausweisungen stattgefunden, die sich aber ausschließlich auf Fremde erstrecken, die mit dem Strafgesetz in Konflikt gekommen waren oder an politischen Demonstrationen teilnahmen. Die politischen Unruhen der letzten Monate haben gezeigt, daß diese Warnung von vielen nicht befolgt wurde, daß eine große Anzahl von Ausländern manifestierte – gegen die Regierung, die ihnen Gastfreundschaft gewährte – ja, daß Ausländer unter den Organisatoren der Unruhen gewesen waren. (…)
Wenn Frankreich heute auf einer schärferen Überwachung der Ausländer besteht, kann ihm daraus wohl keinerlei ernster Vorwurf gemacht werden. Die ökonomische Lage hat ein ständiges Zunehmen der Arbeitslosigkeit zur Folge, und es ist begreiflich, daß bei der Vergebung freier Stellen die Einheimischen vorgezogen werden. Aber noch ein anderer Faktor spielt mit. Der Prozentsatz der durch Ausländer begangenen gemeinen Verbrechen ist im stetigen Zunehmen begriffen und hat in manchen Gerichtsdistrikten dreißig Prozent überschritten. Ganz anders ist es freilich, wenn die Ausländerfrage zu einem Politikum gemacht wird. Frankreich kann auch heute noch nicht ohne ausländische Arbeitskräfte auskommen. Und jene, die gegen den eingewanderten Arbeiter zu Felde ziehen, ohne zu bedenken, daß einzelne Kategorien, wie Erdarbeiter, Maurer, Landarbeiter, Bergarbeiter, seit jeher unter den Ausländern rekrutiert wurden, beweisen, daß sie nicht objektiv urteilen.
Wiens Ärzte werden systematisch irregeführt
Es wird nach dem blonden Missetäter gesucht, der die Mediziner der Stadt umtreibt.
Neue Freie Presse am 16. September 1924
In letzter Zeit sind wiederholt Aerzte, die ihre Praxis in der Innern Stadt ausüben, durch fingierte Adressen von angeblich schwer Erkrankten irregeführt worden.
So erschien ein junger Mann mehrere Male in der Wohnung des Arztes Dr. Josef Reis, Weihburggasse 18, und ließ ihm durch die Hausgehilfin Bestellungen zu Patienten übermitteln, deren Adressen sich nachträglich als falsch herausstellten. In ähnlicher Weise mystifizierte anscheinend derselbe Bursche den Art Dr. David Weinstock, Seilerstätte 16, den er zu dem erkrankten Kinde eines Großkaufmannes namens Karl Kary ins Hotel Royal zitierte.
Dort stellte sich heraus, daß die ganze Geschichte erfunden war und daß bereits ein anderer, ebenfalls irregeführter Arzt im Hotel vorgesprochen und sich nach dem angeblichen Herrn Kary erkundigt hatte. Der Missetäter wird als ein etwa 25jähriger, elegant gekleideter, schmächtiger Mann mit schmalem Gesicht und blondem Haar geschildert. Offenbar hat man es mit einer systematischen Irreführung von Aerzten zu tun.
Ob die Leute, die sich diese Bübereien erlauben, die nämlichen sind, die gelegentlich die Feuerwehr mystifizieren, oder ob es ihnen nur darum zu tun ist, in den ärztlichen Wartezimmern Diebstähle zu verüben, läßt sich vorläufig nicht mit Bestimmtheit sagen.
Sturz eines Piloten auf einen Löwenkäfig
Ein Pilot fiel im wahrsten Sinne des Wortes aus den Wolken.
Neue Freie Presse am 15. September 1934
Der englische Pilot Turner fiel heute im wahrsten Sinne des Wortes aus den Wolken, als er aus dreihundert Meter Höhe abspringend, durch den Wind abgetrieben wurde und schließlich auf einem eigenartigen Gittergerüst landete. Als er sich vom Sturz erholt hatte, sah er, daß er sich auf dem Gitter des Löwenkäfigs im Zoologischen Garten von Leatherhead befand.
Die Löwen, die hungrig waren, versuchten unter fürchterlichem Gebrüll nach seinen Füßen zu schnappen. Er konnte jedoch nach fünfzehn Minuten, während deren die Wärter verzweifelt Anstrengungen machten, die Tiere durch blinde Revolverschüsse zu verjagen, aus seiner unangenehmen Lage befreit werden.
Das Geheimarchiv des Kaisers Franz Joseph
Die von der Zeitung nun veröffentlichten Schriftstücke beleuchten in interessantester Weise die Frage: Worin besteht die Wissenschaft und Kunst des Herrschens?
Neue Freie Presse am 14. September 1924
Wir lüften den Vorhang vor Kulissengeheimnissen der Weltgeschichte, in deren Tiefen Einblick zu nehmen bisher noch niemand möglich war. Wir öffnen das Arbeitszimmer des Herrschers, in dem dieser vom frühen Morgen bis abends am Schreibtische saß und mit einem Wort, mit einer Geste, einem Federzug das Schicksal seiner Untertanen und oft auch fremder Nationen entschieden hat. Die Schriftstücke, die bisher hinter den ängstlich behüteten Mauern des einstmaligen kaiserlichen und königlichen Hofarchivs verborgen waren und die wir jetzt der großen Oeffentlichkeit übergeben, beleuchten in interessantester Weise die Frage: Worin besteht die Wissenschaft und Kunst des Herrschens?
Die Dokumente zeigen uns den Kaiser von einer ganz neuen, bisher unbekannten Seite. Sie zeigen uns, daß Franz Joseph oft nicht nur geherrscht, sondern auch regiert, ja sogar verwaltet hat. Er sieht nicht nur die großen, sondern auch die kleinsten Dinge, er pflegt die Verbindungen mit dem Auslande, so wie er es im Interesse seiner Völker und seines Hauses für notwendig erachtet, er wählt seine Leute, Ratgeber und Mittel und läßt sie wieder fallen, so wie er sie zur Erreichung seiner Ziele geeignet oder ungeeignet findet, möge es sich nun um allmächtige Minister oder um einen einfachen Polizeikommissär handeln. Die eine oder andere Zeitungsnachricht erweckt sein Interesse und er verlangt ausführlichen Bericht über das besprochene Ereignis. Hier findet sich die Erklärung, weshalb er den ganzen Tag hindurch am Schreibtisch saß, er verfügte in allen Fragen selbst, und die Initiative, die in der Oeffentlichkeit seinen Ministern zugeschrieben wurde, nahm oft vom Herrscher ihren Ursprung.
Wir haben die sensationellen Urkunden alle im Original erworben: die eigenhändigen Briefe und Depeschen des Kaisers und Königs Franz Joseph, und wir werden einige davon im Faksimile veröffentlichen. Franz Joseph hat nicht die Konzepte der Kabinettskanzlei unterfertigt, sondern seine Briefe und Depeschen an fremde Herrscher, Minister und Mitglieder seines Hauses selbst abgefaßt. Diese eigenhändigen Konzepte, auf denen auch vermerkt ist, ob sie einfach oder chiffriert zu befördern sind, wurden im Wiener Hofarchiv bisher unter sieben Siegeln bewahrt. Es sind dies Briefe und Depeschen an die Kaiserin Elisabeth, an den Kronprinzen Rudolf, an den Bruder des Kaisers, den unglücklichen Kaiser Max von Mexiko, es ist dies der Brief- und Depeschenwechsel mit Kaiser Wilhelm, Zar Nikolaus, Papst Pius, Napoleon III., König Viktor Emanuel, Königin Viktoria von England, mit den deutschen Fürsten, mit den österreichischen und ungarischen Ministern Franz Josephs, mit dem Grafen Julius Andrassy, mit Stephan Bitto, Koloman Tisza, Graf Gustav Kalnoky, Benjamin Kallay, Taaffe usw. Besonderes Interesse verdienen die Depeschen, welche die Freundschaft Franz Josephs für Frau Katharina Schratt, die bekannte Künstlerin des Burgtheaters, beleuchten. Lauter Enthüllungen, die zwischen den Zeilen historische Rückblicke gestatten.
Wir sehen den Kaiser, wie er schreibt, wie er am Schreibtisch Berichte entgegennimmt, Akten studiert, Verfügungen trifft, wie er auch im hohen Greisenalter bestrebt ist, die Traditionen, die Macht und den Glanz vergangener Jahrhunderte zu erhalten. Wir sehen, wie er schließlich selbst vom Schicksal erfaßt wird und wie sein zum Tode verurteiltes Reich zusammenbricht.
In unverwelkter Erinnerung steht die Gestalt der Kaiserin Elisabeth vor uns. Die schöne, gute bayerische Prinzessin erscheint im prunkvollen Schloß von Schönbrunn. Und an ihrem Lebensabend sehen wir sie wie einen Schatten umherirren, ruhelos nach Ruhe suchend. Sie flieht ihr Heim, sie ist fast nie an der Seite ihres Gemahls – was mag es gewesen sein, was die Gatten einander entfremdete? Diese Frage wirft auch ein Mitglied der unmittelbarsten Umgebung Franz Josephs in einem jüngst erschienenen Buche auf, ein Vertrauter, der Gelegenheit hatte, in das Familienleben des Kaisers Einblick zu tun. Die Ursache liegt in erster Reihe in der Erzherzogin Sofie, der Mutter Franz Josephs, die anfangs selbst die Herrschaft führte und die junge, den Kinderschuhen kaum entwachsene Frau derart einschüchterte, daß sie Wien und ihren Gemahl nach Möglichkeit mied. Der Autor des Buches charakterisiert das Leben des Herrscherpaares mit den Worten Balzacs: Die Gatten verstanden sich am besten, wenn sie nicht beisammen waren …
Die Depeschen aber, die wir nun veröffentlichen, rücken das Verhältnis Franz Josephs zur Kaiserin Elisabeth in ein ganz anderes Licht. Wir sehen aus diesen Depeschen, daß der Kaiser von der zärtlichsten Liebe zu seiner Gemahlin erfüllt war. Seine Sorgfalt begleitete sie auf allen ihren Reisen, er sorgte für ihre Bequemlichkeit und Sicherheit. Aus den Depeschen geht nicht nur die Ritterlichkeit des Kaisers, sondern auch das warme Empfinden des Gatten hervor. Der Schmerzensschrei des Kaisers war echt und kam aus dem Herzen, als sein Generaladjutant Graf Paar ihm die Nachricht von dem furchtbaren Anschlag Lucchenis mitteilte. Damals rief Franz Joseph aus: „Niemand weiß es, wie sehr ich diese Frau geliebt habe!“
Aber auch die Kaiserin Elisabeth war von liebevoller Sorgfalt für ihren Gemahl erfüllt, und sie gab auch aus der Ferne Weisungen, wie er speisen, wie er sich kleiden, wie man seine Wohnräume heizen und lüften solle.
Hier ein kurzer Auszug aus den Depeschen:
Kaiserin Elisabeth befürchtet das Hinscheiden ihres Vaters, sie will an sein Krankenbett eilen, der Kaiser, besorgt um ihre Gesundheit, will sie zurückhalten. Der Kaiser schreibt an die Kaiserin in Korfu.
„Ich rate Dir dringend, nicht nach München zu reisen, denn Du könntest Dich bei der gegenwärtigen Kälte leicht verderben, auch macht es mir den Eindruck, daß es mit Papa schnell zu Ende gehen wird und Du gewiß zu spät kommst. Sollte das Unglück geschehen, so gehe ich jedenfalles zum Leichenbegängnis nach München.“ (Expediert den 13. November 1888 um 3/4 5 Uhr abends)
Der Kaiser an die Kaiserin in Miramar bei Triest.
„Glücklich in Landskron eingetroffen bei herrlichem Wetter, sind meine Gedanken bei Dir und begleiten Dich auf der blauen See.“ (Expediert am 2. September 1894, früh)
Eine nationalsozialistische Demonstration in der Wiener Innenstadt
Eine Versammlung wurde aus Rücksicht für die öffentliche Ruhe und Ordnung verboten.
Neue Freie Presse am 13. September 1924
Die nationalsozialistische Partei hatte für gestern abend in das Etablissement Weigl in Meidling eine Versammlung mit der Tagesordnung: „Protest gegen die Billigung des Versklavungsplanes durch den deutschen Reichstag“ einberufen. Als Referent war der Obmann der reichsdeutschen Nationalsozialisten Hermann Esser aus München angekündigt. Die Versammlung wurde, weil Gegendemonstrationen zu besorgen waren, aus Rücksichten für die öffentliche Ruhe und Ordnung verboten.
Nun berief die nationalsozialistische Partei für die gestrigen Abendstunden eine § 2-Versammlung in das Restaurant Tischler in der Schauflergasse ein. Zu dieser Versammlung waren etwa tausend Personen gekommen, von denen aber ein Großteil nicht in den Saal gelangen konnte und in der Schauflergasse Aufstellung nahm. Nach Schluß dieser Versammlung wollten die Versammlungsteilnehmer in geschlossenem Zuge auf die Ringstraße marschieren, doch wurde dies von der Polizei untersagt. Wegen dieses Verbots wollten die Versammlungsteilnehmer eine Deputation in das Bundeskanzleramt am Ballhausplatz entsenden, verschoben aber ihr Vorhaben auf morgen, da zu dieser Zeit im Bundeskanzleramt keine offizielle Persönlichkeit zur Uebernahme des Protestes gegen das Verbot der Versammlung beim Weigl anwesend war.
Nach Schluß der Versammlung marschierten die Teilnehmer auf den Ballhausplatz und brachen dort in Heilrufe auf den Bundeskanzler aus. Nach Absingung des Liedes „Deutschland, Deutschland über alles …“ zerstreuten sie sich nach einer Aufforderung des Parteiobmannes Schulz in kleinen Gruppen in vollständiger Ruhe.
Weltflug in den Skandal
Arturo Locatelli wollte einen Rekord aufstellen, doch der Versuch wurde ihm in der Heimat bloß mit Entrüstung und Protest quittiert.
Neue Freie Presse am 12. September 1924
Der große Ozeanflug Arturo Locatellis hat noch ein sonderbares Nachspiel gehabt. Man weiß, daß Locatelli im Ozean von einem amerikanischen Begleitschiff aufgelesen wurde. Das hat in Italien, wo man auf ihn überschwängliche Hoffnungen gesetzt hatte, schon empfindlich enttäuscht.
Die Italiener rühmten ihm nach, daß er im Krieg den „feindlichen Himmel“ oft bezwungen hatte; er überflog Ungarn, Wien, Fiume, auch wollte er Amundsen begleiten und nach dem Scheitern von dessen Expedition gedachte er, die amerikanischen Weltflieger erfolgreich zu konkurrenzieren.
Der junge Lombarde hat einen ungemessenen Ehrgeiz, der ihn auch in die Politik geführt hat, er sitzt in der Kammer nicht bloß als mit Orden bedeckter Kriegsheld, sondern als faschistischer Abgeordneter. Sein sportliches Mißgeschick galt den Leidenschaftlichen wohl auch als Niederlage der Partei, deren stolzer Aufflug in jüngster Zeit ja ebenfalls zahlreiche Unterbrechungen erleiden mußte.
Locatelli, von den Amerikanern geborgen, flog nicht stolz mit seinen Begleitern in Newyork ein, sondern kam höchst bescheiden mit der Eisenbahn von Kanada an, aber seine Ankunft gab den zahlreichen Gegnern des Faschismus in der nach vielen Hunderttausenden zählenden italienischen Kolonie von Newyork Gelegenheit zu einer großen Demonstration.
Statt als Sieger einzufliegen und bejubelt zu werden, tobte eine wildbewegte Menschenmenge gegen den faschistischen Deputierten ihre Abneigung aus, er und seine Begleiter mußten von der amerikanischen Polizei gegen tätliche Angriffe geschützt werden, und der Lärm führte zu ernsthaften Kämpfen. Das hätte Locatelli in Italien eigentlich bequemer haben können, dazu war es nicht notwendig, über den halben Erdball zu fliegen, im grönländischen Eis zu erstarren, Gefahren und Schmerzen zu erdulden, um sich nachher von einer Menge unzufriedener Volksgenossen auspfeifen und beschimpfen zu lassen.
Locatelli suchte einen neuen Flugrekord, aber es ist ihm bloß gelungen, einen Rekord im aviatischen Pech aufzustellen.
Der Kardinal und die Kindererziehung
In einem Hirtenbrief nimmt sich der Wiener Erzbischof der Frage an, wie die Kinder „gerettet werden können“.
Neue Freie Presse am 11. September 1924
Der Erzbischof von Wien Kardinal Piffl hat einen Hirtenbrief an die katholischen Eltern erlassen, in dem es heißt:
„Die Erziehungspflicht in der Familie ist gerade heute für euch eine umso dringendere Gewissenspflicht, als die Schulen, denen ihr eure Kinder zur Erziehung anvertrauen müßt, auf die Religion als Erziehungsfaktor vielfach geflissentlich verzichten. Wohl hängt noch in vielen Schulen das Bild des göttlichen Menschheitserziehers Jesus Christus, aber die dortige Erziehung will von ihm nichts wissen, weder von seiner befreienden Heilsbotschaft, die einst das Angesicht der Erde erneuert hat, noch von seinen Geboten, deren gewissenhaste Beobachtung allein der ruhelosen Welt den sozialen Frieden zu geben vermag, noch von seinen Gnadenmnitteln, mit denen er der heilsbedürftigen Menschheit seit neunzehnhundert Jahren immer wieder zu Hilfe kommt.
Auch das Gebet ist in vielen Schulen verstummt und der Name Gottes aus den Lehrbüchern gestrichen. Eure Kinder werden nur mehr für diese Welt erzogen; Ewigkeitswerte kennt die moderne Kindererziehung nicht mehr und in der christlichen Glaubens- und Sittenlehre tief verankerten Lebenswahrheiten sind nicht mehr das Fundament der heutigen Schulbildung. Deshalb wende ich mich an euch, katholische Eltern, und mahne und beschwöre euch, alle gesetzlichen Mittel der Selbsthilfe zu ergreifen, um die gefährdeten Seelen eurer Kinder zu retten. Ein solches Mittel der Selbsthilfe sei das Zusammenschließen der Erziehungs- und Schulorganisation der Katholiken Oesterreichs.“
Ein Hellseher klärt einen Mord auf
Eine Fotografie und ein Signal eines (toten) Gehirns führten den Hellseher in ein Bananengeschäft – und die Polizei mit ihm.
Neue Freie Presse am 10. September 1934
Die achtjährige Sonja Beugeltasch verschwand in Amsterdam auf dem Wege zur Schule. Da die Polizei absolut keine Spur finden konnte, wandte sie sich an einen ihr bekannten Telepathen, der sich aber auch als Hellseher bezeichnet. Man gab ihm eine Photographie des vermißten Kindes, er sah sie eine Weile an, sagte: „Gut!“
Und begann in die Richtung des Viertels zu gehen, in dem die kleine Sonja gewohnt hatte. Wie er sagte, hoffte er, auf der Straße eine Person zu finden, die er auf irgendeine Weise mit der Verschollenen in Zusammenhang bringen könnte. Vor einem Bananengeschäft blieb er plötzlich stehen und erklärte, nicht mehr weitergehen zu können, jetzt müsse er am Ort der Tat sein. Die Polizisten drangen in das Haus ein und sichten so lange, bis sie die Leiche des Mädchens in einer leeren Bananenkiste fanden. Es waren Anzeichen dafür vorhanden, daß das Kind einem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen war.
Ein junger Angestellter wurde verhaftet, obwohl er jede Verbindung mit dem Verbrechen in Abrede stellte. Als man ihn in das Polizeiauto bringen wollte, nahmen die Bewohner der Straße eine so drohende Haltung gegen den Bedrängten ein, daß ihm die Polizei nur durch das Abfeuern einiger Schreckschüsse vor dem Lynchtode bewahren konnte. Der Hellseher behauptet, daß er das Opfer nicht „gesehen“ habe, sondern durch die Gedankenströme des Täters darauf gelenkt worden sei, wenn nicht durch die der armen Sonja selbst. Denn das sendende Gehirn müsse nicht unbedingt einem Lebenden angehören, auch verstorbene wären imstande, telepathische Botschaften zu übermitteln.
Jedenfalls habe er vor dem Gebäude, in dem sich die Bananenhandlung befand, augenblicklich einen Chok verspürt und dadurch sofort gewußt, daß er hier in Beziehung zu dem Fall getreten sei, auf den er sich mittels der Photographie eingestellt hatte.
Ein großer Erfolg der deutschen Armee
40.000 Kriegsgefangene wurden bei der Einnahme von Maubeuge gemacht. 400 Geschütze fallen nun in die Hände der Deutschen.
Neue Freie Presse am 9. September 1914
Die Festung Maubeuge, welche den Weg längs des Flußlaufes der Sambre an der belgischen Grenze in der Richtung über St. Quentin nach Paris sperrt, hat gestern kapituliert. Vierzigtausend Kriegsgefangene und vierhundert Kanonen sind die Beute der Deutschen geworden. Von der Bedeutung dieser Festung mögen folgende Zahlen ein Bild geben.
Die Zahl der Gefangenen nach dem Falle von Straßburg im früheren Kriege mit Frankreich betrug rund siebenundzwanzigtausend. Die Kapitulation von Sedan machte dreitausend Offiziere, dreiundachtzigtausend Mann, und vierzehntausend Verwundete zu Gefangenen, und gleichzeitig wurden vierhundertneunzehn Feldgeschütze und Mitrailleusen erbeutet.
Der General Seré de Rivieres hat den Schwerpunkt der Verteidigung gegen Deutschland in die Festungen verlegt. Dort sollte die französische Armee den Schutz finden, um ihre Mobilisierung und ihren Aufmarsch vollziehen und die Richtung ihres Vorstoßes selbst wählen zu können. Gleichzeitig sollten die Festungen unübersteigliche Weghindernisse für den Feind werden. Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Die deutschen Armeen, geführt von den Generalobersten Kluck, Bülow, Hausen und dem Herzog von Württemberg, sind im vollen Vormarsch begriffen und wurden von den Festungen nicht aufgehalten.
Der Gürtel der Forts ist zersprengt worden, und wieder hat sich gezeigt, daß die Schicksale der Völker sich nur in der Feldschlacht entscheiden können. Festungen können gewiß durch ihre Lage eine Schwierigkeit für den Feind werden, aber zugleich entziehen sie der eigenen Armee viele Kräfte durch den Menschenverbrauch, den sie zu ihrem eigenen Schutze nötig haben.
Die Franzosen haben durch die Kapitulation vierzigtausend Mann verloren, und mindestens die gleiche Kraft ist auf deutscher Seite frei geworden, so daß der Verlust doppelt wirkt durch die Schwächung der eigenen Armee und durch die Stärkung der feindlichen. Die Kapitulation von Maubeuge gibt den Deutschen die Herrschaft über wichtige Verkehrsmittel, erleichtert ihren Vormarsch gegen Ungarn und sichert ihre Verbindungslinien mit der Heimat.
Heizt heimisches Holz!
Ein Aufruf von Sektionsrat Ing. Dr. Klimesch.
Neue Freie Presse am 8. September 1934
Als mir im Vorjahr die Organisation der Brennholzpropagandaausstellung auf der Wiener Herbstmesse übertragen wurde, hieß es, Neuland betreten. Ein Jahr ist vergangen. Im Frühjahr 1934 war das Holz schon in den Brennstoffverordnungen gleichberechtigter Partner der heimischen Braunkohle. Und die letzten Wochen haben die große Aktion des Regierungszuschusses von 300.000 G. zur Förderung des Neu- und Umbaues von Holzheizungsstätten gebracht.
Bei Umbauten oder Neuanschaffungen von Holzheizungsöfen werden den Verbrauchern aus den erwähnten Mitteln Zuschüsse bis zu 30 Prozent der Kosten gewährt. Diese Aktion ist der Initiative von Gewerbe und Industrie zu danken, die aber auch sonst nicht müßig gewesen sind: Der Reichsverband der Hafner Oesterreichs hat die Bevölkerung über die Vorzüge des mit Holz geheizten Kachelofens aufgeklärt und Werbung und Aufklärung auch in die Reihen seiner eigenen Fachgenossen getragen.
Durch eine sehr lehrreiche, eingehende Anweisung zum Bau von Kachelöfen für Holzheizung wird es auch den Hafnern in der Provinz ermöglicht, die neuesten Erfahrungen auf dem Gebiete des Kachelofenbaues zu verwerten, so daß einwandfrei konstruierte Kachelöfen für Holzheizung gegenwärtig eigentlich eine Selbstverständlichkeit sind.
Der glücklichste Tag eines Ehemannes
Im Juni oder Juli, wenn der Mann mit den Motten und dem Sommerstaub alleine ist, dann steht die Häuslichkeit still. Danach heißt es: Krieg!
Neue Freie Presse am 7. September 1924
Ein Ehemann schreibt uns: Die bekannten „zwei glücklichen Tage“, von Blumenthal und Kadelburg, nämlich der Tag, an dem man eine Villa erwirbt, und der andere, an dem man sie wieder los wird, spielen auch im Kalender der Häuslichkeit und des Familienlebens eine große Rolle. Der eine glückliche Tag ist der Juni- oder Julitag, an dem der Wirtschaftsbetrieb stillgelegt wird, die Familie aufs Land geht und das Oberhaupt unbetreut und unbedient mit den Motten und dem Sommerstaub endlich allein ist.
Wesentlich glücklicher aber ist doch der Tag, an dem der Häuslichkeitsbetrieb wieder aufgenommen wird, was freilich nicht ganz reibungslos vor sich geht: bei uns wird sogar aus diesem Anlaß erschütternd viel gerieben, gebürstet und geputzt. Die gestern noch idyllisch staubige und traulich vernachlässigte Wohnung wird plötzlich zum Tummelplatz wilder Bedienerinnenleiden. Unter der Devise „gründlichräumen“ ereignen sich alle Greuel einer unerbittlichen Kriegsführung. Zum Zeichen der Feindseligkeit haben sich die diversen weiblichen Wesen den Kopf mit Tüchern eingebunden, andere Tücher tragen sie in Händen, an die Schürze angesteckt oder sie drapieren damit die große Sesselleiter, die derart den beängstigenden Eindruck eines Sturmbocks macht, wie er in alten Zeiten zur Einnahme von Festungen diente.
Ein Zimmer nach dein andern wird auch mühelos von den vereinigten Bedienerinnen und Hausgehilfinnen erobert, nur das Arbeitszimmer ist „noch in meinem Besitz“, bis ich, von allen Seiten zerniert, vor den enervierenden Aufräumungsgeräuschen die Flucht ergreife. Aber wenn dann die Schlacht geschlagen und das letzte Zimmer fertig ist, sogar das Vorzimmer samt Nebenräumen, wenn die Vorhänge angebracht und die Teppiche aufelegt sind, dann kommt es einem mit einem Male zum Bewußtsein, was für eine schöne, angenehme Wohnung man hat, und daß es eigentlich kein besseres Vergnügen gibt als Wohnen.
Man geht durch die Räume wie durch eine Ausstellung am Tag vor der Eröffnung für das große Publikum, und alle die wohlbekannten Dinge erscheinen einem neu und reizvoll. Das Silber im Glaskasten, das schöne Geschirr in der Kredenz, sagt ganz deutlich: „Da schau’ mich an. Hast du das nötig gehabt, den ganzen Sommer auf miserablem Gasthausgeschirr zu essen?“ Und der gemütliche Ohrenfauteuil unter der Stehlampe sagt einladend: „Komm‘ her, nimm’ Platz. Hier sitzt sich’s besser, ungestörter, als in der erstklassigsten Hotelhall.“
Der Höhepunkt dieses Firnistages ist aber das erste Nachtmahl zu Hause. Nach langen, entbehrungsreichen Erholungswochen sitzt man endlich wieder mit der Gattin allein bei Tisch, ohne Bekannte und Verehrer, freut sich der Akkuratesse, der Ordnung, der häuslichen Küche und denkt sich: Ach, wenn es doch nur immer so bliebe, wenn die Ausstellung nie für den allgemeinen Besuch eröffnet würde. Aber bevor ich diesen Wunsch noch aussprechen kann, sagt meine Gattin schon entschlossen: „Gott sei Dank, daß die Wohnung fertig ist. Übermorgen hab‘ ich meine erste Bridgepartie…“
Die erste österreichische Eisenbahn
Eigentlich ist Österreichs Eisenbahn gar nicht 100 Jahre alt – oder doch? Nun ja, je nachdem, wie man rechnet.
Neue Freie Presse am 6. September 1924
Jede alte Eisenbahn fuhr mit ihrem eigenen Witz.
Die österreichische mit dem des Kaiser Franz über die leeren Stellwagen: Wien-Brünn. Die deutsche mit denen des Königs Friedrich Wilhelm III. und seines Verkehrsministers v. Nagler. Er antwortete dem einer Bahn Berlin-Potsdam Vorschlagenden: „Dummes Zeug! Ich lasse täglich sechs Sitzposten nach Potsdam gehen, und es sitzt niemand drinnen. Wenn Sie ihr Geld absolut los werden wollen, so werfen Sie es doch gleich liebe zum Fenster hinaus, ehe Sie es zu solch unsinnigem Unternehmen hergeben!“ Und der König meinte, er könne sich keine größere Glückseligkeit vorstellen, ob man einige Stunden früher in Potsdam ankomme oder nicht.
Als schließlich vor etlichen achtzig Jahren der erste Zug aus Berlin in Potsdam einlief, ergriff der dortige Polizeidirektor Flesche, der den Zug erwartete, vor der neuartigen Erscheinung die Flucht, mit den Worten: „rette sich wer kann!“ Aerzte glaubten damals, Dampfbetrieb erzeuge Gehirnkrankheiten. Andere meinten, die Verkehrslangsamkeit sei nicht ungesund und Metternich fürchtete politische Schäden von der durch Eisenbahnen ermöglichten Freizügigkeit.
Solche Bedenken löste die allererste österreichische Eisenbahn, deren hundertster Geburtstag jetzt in Budweis gefeiert wird, nicht aus. Sie raste allerdings nicht unter Volldampf von Budweis nach Linz, sondern wurde von mehr oder weniger feurigen Rossen gezogen. Dennoch verdient sie „Eisenbahn“ genannt zu werden, denn sie bewegte sich auf eisernen Schienen. Sie fuhr auch nicht am 7. September 1824.
Von diesem Tage datiert nur die dem ehemaligen Wiener Technikprofessor Franz Anton v. Gerstner erteilte Konzession zum Bau einer zwischen Mauthausen und Budweis Donau mit Elbe verbindenden Eisenbahn. Diese 129 Kilometer lange Bahn, mit den späteren Kopfstationen Linz und Budweis, wurde am 1. August 1832 vollendet und als Pferdebahn dem Betrieb übergeben. Ihren wirklich bewegten Geburtstag wird sie somit erst in acht Jahren feiern können.
Wozu ein Telefonanschluss?
Immer mehr Privatpersonen wollen per Telefon vernetzt sein.
Neue Freie Presse am 5. September 1934
Die Zahl der Anmeldungen hat in den letzten Tagen die Zahl von 25.000 weit überschritten. Vergangenen Samstag waren es bereits 25.422. Es ist interessant, wie sich diese neuen Abonnenten verteilen. 20.828 verlangten Viertel-Gesellschaftsanschlüsse, 1996 halbe Gesellschaftsanschlüsse und 2598 Einzelanschlüsse. Daraus geht hervor, daß es meistens Privatpersonen sind die schon lang das Bedürfnis nach einem Telephon hatten, aber infolge der hohen Kosten eine Anmeldung unterließen.
Das Wiener Fernsprechnetz umfaßt nunmehr 114.500 Telephonanschlüsse, die schon im Betrieb stehen. Die gewaltige Zahl der Anmerkungen hat es trotz aller Eile und aller technischen Vorkehrungen und Neuerungen bei angespannter Arbeitsteilung nicht erlaubt, die Aufstellung der neuen Stationen zur Gänze durchzuführen. Etwa 10.000 Anschlüsse, an deren Herstellung bereits fieberhaft gearbeitet wird, sind noch durchzuführen.
Das Wunderkind
Bisher bekannt sind einseitige Begabungen für Musik oder Mathematik, für Sprachen oder andere Wissensgebiete. Giovanni aber kann alles.
Neue Freie Presse am 4. September 1934
Amerikanische Blätter melden die merkwürdige Geschichte eines Wunderkindes. Der siebenjährige Giovanni Zelenna hat ein wahrhaft abenteuerliches Leben hinter sich.
Seine Eltern, verarmte Angehörige des italienischen Mittelstandes, sind in den letzten Jahren durch die ganze Welt gereist. Der Vater, ein begabter, aber von unerhörtem Pech verfolgter Ingenieur, suchte da und dort Beschäftigung. Er fand sie in persischen Oelgruben, auf der Bagdadbahn, in Ankara, in Tokio, Charbin und San Francisco. Aber die Geschichte dieses Mannes besteht nur aus einer endlosen Zahl lückenlos sich aneinander reihender Unglücksfälle.
Jedesmal, wenn er irgendeine Arbeit gefunden hatte, stellte sich ein Zwischenfall ein, der ihn um seine Stellung brachte. Als der kleine Giovanni auf die Welt kam, befand sich das Ehepaar Zelenna in einem Vorort von San Francisco. Wenige Monate war das Kind erst alt, da brach in dem von Zelenna bewohnten Häuserblock eine Brandkatastrophe aus. Das Kind blieb durch einen unglücklichen Zufall in dem brennenden Haus zurück, wurde schließlich gerettet, aber die Eltern erfuhren nichts davon. Sechs Wochen nach dem Brandunglück besuchte Frau Zelenna mit einer Freundin ein Findelhaus und fand dort unerwarteterweise ihr Kind wieder. Das war der einzige Glücksfall seit vielen Jahren. Das Kind wuchs dann heran und entwickelte schon in einem Alter von zwei Jahren ungewöhnliche Fähigkeiten.
Es war offensichtlich frühreif, verstand es, sich selbst anzuziehen, faßt Worte der Erwachsenen mit ungewöhnlicher Intelligenz auf. Lieder, die es einmal gehört hatte, sang es ohne den geringsten Fehler. Mit vier Jahren war es bereits imstande, verhältnismäßig schwierige Rechnungen – Multiplikationen und Additionen – auszuführen, und zwar stets fehlerfrei. Vom fünften Lebensjahr an nahm die geistige Entwicklung des Kindes einen rapiden Verlauf. Der kleine Giovanni sprach um diese Zeit bereits Chinesisch – er hatte es von Chinesenjungen, mit denen er spielte, erlernt – Russisch, Englisch, Italienisch und Deutsch. Das Kind schien mit einem unerschöpflichen Gedächtnis gesegnet zu sein.
Es vergaß überhaupt nichts, was es hörte. Es führte die schwierigsten Rechnungen im Kopf durch, schrieb und las in allen vorhin angeführten Sprachen, zeichnete mit einer erstaunlichen Naturtreue alles Gesehene wieder, spielte Klavier, Violine und Saxophon. Alle diese Begabungen sind jedoch nicht schöpferischer Natur. Das Kind kann nur Gehörtes, Erschautes wiedergeben. Die wunderliche Begabung dieses Kindes erregt deshalb Aufsehen, weil sie keinerlei Begrenzung zu kennen scheint. Die Wunderkinder, von denen man bisher hörte, waren stets einseitig begabt, entweder in Musik oder für Mathematik, für Sprachen oder andere Wissensgebiete. Giovanni aber kann alles.
Das Wunderkind wird gegenwärtig von den Psychologen der Universität in San Francisco untersucht. Man hofft, durch eingehende Beobachtungen und Experimente Interessantes über den Ablauf der psychischen Funktionen bei Wunderkindern zu erhalten.
Der Kampf um den Brotpreis
Wie viel darf ein Laib Brot kosten?
Neue Freie Presse am 3. September 1924
Vom Kriegsschauplatz ist nichts Neues zu melden. Vor allem das nicht, was die Verbraucher mit dem bisherigen Gang der Dinge mit einer gewissen Sicherheit erwarten zu können geglaubt hatten: eine Herabsetzung des Brotpreises. Vorläufig hat sich die Ankerbrotfabrik damit begnügt, zur Kenntnis zu nehmen, daß die Preisprüfungssstelle ihre, der Ankerbrotfabrik, letzte Preisfestsetzung von 8·000 Kronen für den Laib für „offenbar übermäßig“ im Sinne und in der Sprache des Preistreibereigesetzes befunden hat.
Der von seinem Erholungsurlaub nach Wien zurückgekehrte Generaldirektor des Unternehmens hat gestern einen Informationsbesuch bei der Wirtschaftspolizei gemacht. Diese dagegen hat sich jetzt darauf beschränkt, der Oeffentlichkeit nur Kenntnis von ihren Erhebungen festgestellt .Für die Oeffentlichkeit, namentlich für die Arbeiterschaft, wäre es gewiß von Interesse, zu erfahren, ob auch die Hammerbrotwerke von ihren Abnehmern einen offenbar übermäßigen Preis verlangen.
Es ist überhaupt manches unklar in dem bisherigen Gang der von der Regierung mit einem so großen Nachdruck angekündigten Untersuchung in der Brotpreisfrage.
Das verarmte Publikum des Burgtheaters
Trotz aller bisher aufgewendeten Mühen hat sich die Kluft, die zwischen dem Burgtheater und seinem ehemaligen Stammpublikum gähnt, keineswegs geschlossen.
Neue Freie Presse am 2. September 1924
Das Wort stammt vom Direktor des Burgtheaters, der heute einiges über seine Absichten für die kommende Saison mitgeteilt hat. Es sind ungemein gute Vorsätze, und keinen Augenblick soll etwa geargwöhnt werden, daß mit ihnen der Weg in die Hölle gepflastert ist, in das Inferno der ausschließlichen Rücksichtnahme auf den Theaterkassier und dessen entscheidende Rapporte. „Und die Kinder, sie hören es gern …“ Zum Schlusse seiner Ausführungen sprach Direktor Herterich von dem verarmten Publikum des Burgtheaters, womit augenscheinlich alle jene gemeint sind, denen so oft und aus so maßgebendem Munde versichert worden ist, daß das Burgtheater ohne sie überhaupt nicht denkbar sei, daß der Burgtheaterstil sich aus der Wechselwirkung zwischen den großen Künstlern des Hauses und dem verständnisvollsten, dem feinfühligsten Publikum herausgebildet habe, während sie bereits seit geraumer Zeit das Haus auf dem Franzensring nur von außen kennen und auf die Lektüre der im Foyer hängenden Theaterzettel beschränkt sind.
Der Direktor hat vor diesem verarmten Publikum des Burgtheaters, den Angehörigen der geistigen Berufe, den Professoren, den Lehrern, den Richtern und den Aerzten, eine leichte und liebenswürdige Verbeugung gemacht und die ein wenig allgemein gehaltene Erklärung abgegeben, daß er in seinen Bemühungen, ihnen den Besuch des Burgtheaters wieder zu ermöglichen, nicht erlahmen werde. An diesen Bemühungen soll gewiß desgleichen nicht gezweifelt werden, wenn sie auch leider bisher keine besonders greifbaren Resultate gezeitigt haben. Wir wissen freilich genau, daß man uns vorrechnen wird, was alles zu Nutz und Frommen der verschiedenen Kunst- und Bildungsstellen geschehen sei, daß man mit bedauerndem Achselzucken hinzusetzen dürfte, ein Mehr verbiete sich aus naheliegenden Gründen budgetärer Natur. Nichtsdestoweniger wird es gut sein, den Direktor an sein zutreffendes, vielversprechendes und gewiß grundehrlich gemeintes Wort festzunageln und ihn in seinem gewiß nicht leichten Kampf gegen die verschiedenen Faktoren, die leider dreinzureden haben, Sekundantendienste zu leisten.
Trotz aller bisher aufgewendeten Mühen hat sich die Kluft, die zwischen dem Burgtheater und seinem ehemaligen Stammpublikum gähnt, keineswegs geschlossen. Im Gegenteil, sie ist noch breiter, noch unpassierbarer geworden, als es anfänglich der Fall gewesen ist. Und das Schlimmste ist darin gelegen, daß die ursprüngliche Erbitterung der Ausgesperrten in dumpfe Resignation umgeschlagen hat. Sie finden es beinahe selbstverständlich, daß das Burgtheater ihnen verschlossen ist. Sie haben einen dicken Strich unter ihre Burgtheaterschwärmerei von ehedem gemacht und haben sich leichter oder schwerer damit abgefunden, daß sie dort überhaupt nichts mehr zu suchen haben. Es muß jedoch nicht zum xtenmal betont werden, daß in solcher erzwungener Entfremdung der besten Elemente des Publikums die wirkliche, die ungelöste Burgtheaterkrise gelegen ist, eine Krise, die durch das Palliativmittel von so und so vielen Sitzen zu ermäßigten Preisen, die für irgendeine Lückenbüßervorstellung den Organisationen zur Verfügung gestellt werden, nicht aus der Welt geschafft werden kann.
Der Wiederaufbau des Burgtheaterpublikums von einst muß systematisch betrieben werden. Man darf nicht einmal vor der unleugbaren Tatsache zurückschrecken, daß just das verarmte Publikum des Burgtheaters zu seinem größten Teil sich nur am Sonntag den Theaterbesuch zu leisten vermag. Aus materiellen Gründen im allgemeinen und im besonderen deshalb, weil die Angehörigen der geistigen Berufe die Abendstunden der Wochentage zumeist jenen Nebenbeschäftigungen widmen müssen, auf deren Erträgnisse sie angewiesen sind. Das Defizit der Staatstheater würde aber dadurch kaum eine unerträgliche Steigerung erfahren, daß man sich gerade an Sonn- und Feiertagen an jene Schichten der Bevölkerung erinnert, die gegenwärtig nicht in der Lage sind, in ihr Budget den Posten „Kulturbedürfnisse“ einzustellen.
Der Siebenuhr-Ladenschluss
Wenn sogar die Straßenbahn eine Stunde länger als vergangenen Winter verkehren darf, so ist wirklich nicht einzusehen, warum nicht auch die Detailgeschäfte eine Stunde länger offenbleiben dürfen.
Neue Freie Presse am 1. September 1924
Wir erhalten folgende Zuschrift: „Bezugnehmend auf die ausgezeichneten Darlegungen des Herrn Dr. Rudolf Brichta in dem Leitartiekl Ihres sehr geschätzten Blattes vom 28. d., gestatte ich mir, darauf hinzuweisen, daß auch der Siebenuhrladenschluß einen dringenden Wunsch der Detailkaufmannschaft mindestens der Innern Stadt darstellt. Wie erinnerlich, bestand vor dem Kriege sogar der Achtuhrladenschluß, der infolge der durch die Kohlennot notwendigen Beleuchtungsersparnisse sukzessive der Sechsuhrsperre (vorübergehend sogar der Vieruhrsperre) Platz machen mußte. Nun ist es gerade in Anbetracht der Anwesenheit der ausländischen Delegierten vielleicht nicht unangebracht, daran zu erinnern, daß die Stunde von Sechs bis Sieben für den Verkauf an die kauflustigen Fremden erfahrungsgemäß in erster Reihe in Betracht kommt. Nach dem Five o‘clock-tea nehmen diese sich erst Zeit, nach Erledigung ihrer geschäftlichen Konferenzen oder Besichtigung der Sehenswürdigkeiten ihre Einkäufe in den Detailgeschäften vorzunehmen, und gerade da sind wir Kaufleute gezwungen, ihnen den Laden sozusagen vor der Nase zuzusperren.
Wenn jetzt sogar die Straßenbahn eine Stunde länger als vergangenen Winter verkehren darf, so ist wirklich nicht einzusehen, warum nicht auch die Detailgeschäfte eine Stunde länger offenbleiben dürfen, was uns überdies einen Schritt näher zu vorkriegsmäßigen Verhältnissen bringen würde. Es liegt dabei den Unternehmern vollkommen fern, dadurch den Angestellten ihre sozialpolitische Errungenschaft des Achtstundentages gefährden zu wollen, indem man entweder nach dem Berliner Beispiel es den Geschäften freistellen könnte, entweder von 8 bis 6 oder von 9 bis 7 offen zu halten, oder indem man im Winterhalbjahr von 9 bis 7 und im Sommerhalbjahr (15. April bis 15. September) von 8 bis 6 Uhr Geschäftszeit hätte.
Eventuell wäre auch die Einführung eines Schichtwechsels der Angestellten möglich. Es ist wohl zweifellos, daß bei gegenseitigem guten Willen die zur Milderung der herrschenden Absatzkrise gewiß beitragende Siebenuhrsperre im Interesse der schwerringenden Unternehmungen durch Verordnung der Landesregierung raschestens wieder eingeführt werden könnte, was gewiß von der gesamten Detailkaufmannschaft lebhaftest begrüßt werden würde. Ich wäre einer sehr geehrten Redaktion sehr dankbar, wenn sie diesen Bestrebungen eventuell durch Veröffentlichung in Ihrem führenden Blatte Ihre wirksame Unterstützung leihen würde und empfehle mich mit dem Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung ergebenst Ernst Förster, Prokurist der Firma A. Förster.“

إرسال تعليق